|
| |
|
Das altpreußische
Weiberfest
von Wilhelm Gaerte |
 |

Um das Jahr 1283 hatte der deutsche Ritterorden
den östlichsten Stamm der Preußen, die Sudauer, unterworfen. Viele Bewohner des
dortigen Landesteiles, die sich nicht vor dem Kreuze beugen wollten, fanden ein
Asyl im benachbarten litauischen Gebiet. Etwa 1500 Sudauer, die das Christentum
annahmen, verpflanzte der Orden nach dem Nordwestwinkel des Samlandes, der von
den Angesiedelten den Namen „Sudauischer Winkel“ erhielt.
Wie eine alte Chronik (Henneberger, Erclerung der
Preußischen größeren Landtaffel 1595) erzählt, erhielt der einst in jener Gegend
beamtete Bernsteinmeister Johann Furchs den Besuch einiger Freunde. Furchs hielt
auf glänzende Aufmachung. Den Gästen zu Ehren gab daher der Bernsteinmeister ein
Fest, dessen Höhepunkt ein Tanz von geschmückten sudauischen Weibern bildete. Es
waren ihrer zehn. Bevor sie aber den Tanz begannen, stellten sie die Bedingung,
die Tonne Bier, die ihnen der Bernsteinmeister zugesagt hatte, vor dem Tanze
austrinken zu dürfen. Ihre Bitte wurde gewährt, und mit Leichtigkeit bezwangen
die zehn sudauischen Frauen das immerhin reichliche Maß des berauschenden
Trunkes. „Ihre Männer aber mußten solches mit beschwertem Gemüt von ferne
anschauen, Darüber erhob sich nicht wenig Freude mit seltsamem Tanzen, Singen
und Entblößung ihrer Haare, die sie gleich den Ohren abgeschnitten und trieben
auch sonst allerlei wunderliche Possen.“
Daß dieses merkwürdige Geschehnis für das besagte
Fest ein improvisiertes Einzelereignis darstellt, kann man nicht annehmen. Dafür
hat es eine zu bestimmte Form und Gestalt mit augenscheinlich feststehenden
Einzelbegebenheiten. Nach dem Bericht vollzog sich die Vorführung in folgenden
Stufen: Zunächst wurde getrunken, um in „Stimmung“ zu kommen, dann erst begann
ein seltsames Tanzen. Ob dieses von dem erwähnten Gesang begleitet oder ob das
Singen ein besonderer Teil der Aufführung war, steht dahin. „Allerlei
wunderliche Possen“ wurden außerdem getrieben, und das Ganze spielte sich in
ausgelassenem Frohsinn ab, was bei der Menge des genossenen Bieres verständlich
erscheint. Bemerkenswert sind noch zwei weitere Erwähnungen: Die Männer der
Weiber schauen von ferne zu und die Weiber entblößten ihre Haare.
Wir dürfen feststellen, daß es sich um einen
reinen Weibertanz und Gesang im berauschten Zustand mit teilweiser Entblößung
und allerlei Possen handelte. Nach allem kann man auf das Brauchtum im
altpreußisch-sudauischen Volke schließen, das eine traditionelle Weiberfeier in
einigen wesentlichen Zügen widerspiegelt. Daß ein solches Verhältnis wirklich
vorliegt, beweisen die Weiberfeste, die noch heute im Ostbaltikum in Übung sind.
Solche Feiern sind nach Loorits aus der Gegend um
den Peipus-See an den Ufern des Narva-Flusses und ferner südlich des Peipus-Sees
im Kreis Petschus bei den dort lebenden Russen bekannt. Aber auch bei den
estnischen, griechisch-orthodoxen Setukesen, steht der Brauch in voller Blüte;
in Lettland dagegen sind nur noch spuren davon erhalten. Eine wie große
Verbreitung das Fest sicherlich im übrigen Rußland haben mag, dafür zeugt die
Erwähnung der Feier für den Kaukasus und die Gegend von Saratov an der Wolga.
„Dieses Fest gehört nicht zu jenen, die überall
an denselben Tag gebunden sind, sondern die Zeit der Feier ändert sich je nach
Dorf oder Landstrich und hängt von örtlich bedingten Umständen ab“. Erwähnt
werden als Tage der Begehung des Weiberfestes der St. Georgtag (23. April), der
Eliastag, der Blasiustag (11. Februar), vornehmlich die Woche vor der Fastenzeit
zu den großen Fasten. Gewöhnlich findet die Feier nur einmal im Jahre statt. „In
einigen Dörfern wird das Weiberfest sogar mehrere Male im Jahr gefeiert,
wenigstens einmal im Winter zur Weihnachts- oder Fastnachtszeit und ein zweites
Mal im Sommer“.
Als Ort der Festfreude wird das Wohnhaus eines
Gehöftes gewählt. Man tritt aber auch in die Öffentlichkeit hinaus und tollt
sich auf der Dorfstraße, ja auch im Nachbardorf aus. „Als Festhaus werden meist
größere Häuser ausersehen. Ist im Dorf ein verwitwetes Weib und hat dieses ein
größeres Haus, dann wird dort meistens alle Jahre das Fest oder der Weiberkirmes
begangen“. Es kommt auch vor, daß jährlich der Ort der Feier wechselt.
In manchen Berichten wird die Persönlichkeit
einer Festleiterin hervorgehoben; es ist dies „die Älteste“ –mitunter ist sie
noch jung an Jahren- in deren Haus das Fest abgehalten wird. Sie organisiert die
Vorbereitungen, insbesondere die Sammlungen, und sieht zu, daß beim Fest alles
in Ordnung vor sich geht, vornehmlich, daß jede Festteilnehmerin nicht zu kurz
im Essen und Trinken kommt; sie selber trinkt nicht viel. Ihr zur Seite stehen
gewöhnlich zwei „Ausrichterinnen“, „Vertrauensweiber“, welche die Getränke und
Speisen von den Dorfbewohnern besorgen.
Das Weiberfest beginnt mit dem Sammelgang. „Das
ältere Weib ersieht sich dann noch zwei oder drei Weiber, und sie gehen im Dorf
sammeln. Ein Tuch wird schön an eine lange Stange gelegt, daraus wird die Fahne.
In die Hand wird eine Glocke genommen, mit der geklingelt wird. Unterwegs wird
auch gescherzt. Kommt man im hof eines Gehöftes an, dann wird geklingelt und
Pferdewiehern nachgeahmt, als ob man mit einem richtigen Pferde gefahren sei“.
Ein anderer Bericht: „Zu allererst, wenn die erste Versammlung abgehalten werden
soll, dann ziehen sich einige unternehmendere Weiber umgewendete Pelze an,
hängen sich Halsglocken um den Hals, nehmen Ofenbesen und –krücken in die Hand,
manche zieht sich auch noch Hosen an, und so fangen sie an, die Weiber
zusammenzubringen“. Oder: „Das Fest beginnt damit, daß ein Weib sich das Gesicht
mit Ruß verschmiert, einen Pelz verkehrt anzieht, eine große Deichselglocke in
die Hand nimmt, und beginnt die Gehöfte des Dorfes durchzugehen und die Weiber
zum Fest zu läuten“. „Manchmal haben etliche Weiber sich als Bettler verkleidet,
sich Hosenlumpen angezogen, einen Stecken in die Hand genommen und einen alten
zerlumpten Sack auf die Schulter, und so sind sie ins Dorf betteln gegangen“.
Am Tage des eigentlichen Festes erscheinen die
Weiber des Dorfes schön geschmückt. Sie tragen ihre Volkstrachten, „man soll
auch Silber um den Hals haben“. In einem Dorf „legen sich die Weiber Putzfedern
an die Stirn“. Da es sich um ein ausschließliches Weiberfest handelt, und zwar
nur um ein solches verheirateter Frauen, bestehen strenge Regeln für die
Abhaltung des Festes. Männer nehmen an der eigentlichen Festfreude nicht teil.
„Die Männer“, heißt es, „hüten zu Hause die Kinder“. Oder: „Die Männer sehen
sich natürlich den Spaß aus ehrerbietiger Entfernung an“. „Männer werden von den
Weibern nicht mitgenommen außer einem Spielmann. Zusehen lassen sie freilich
auch Männer wie Burschen des Dorfes und die Mädchen geben allen Schnaps und
Bier“. „Desgleichen wurde es alten Jungfern nicht gestattet, den Festraum auch
nur mit dem Fuß zu betreten“. Dasselbe gilt für lettländischen Brauch.
Ursprünglich wird sich wohl das Weiberfest
vollständig im Geheimen abgespielt haben. Dafür zeugt der Bericht über die Feier
eines Dorfes; „Was auf dem Weiberfeste getrieben wurde und wird, ist den
breiteren Massen unbekannt und soll unbekannt bleiben“.
Jungvermählte spielen auf dem Weiberfest eine
besondere Rolle, haben bestimmte Pflichten und erhalten besondere Ehrung aus
einem Grunde, dessen öfters Erwähnung getan wird: „Nach der Tradition geht auch
hier die ´Einsegnung´ der jungen Frauen, die sich im Jahr vorher verheiratet
haben, vor sich. Diese werden gar nicht unter die Frauen gerechnet, bevor sie
eine dreifache Portion Schnaps und Aether hingelegt haben. Das Fest vollzieht
sich zur Begleitung eigenartiger ´Einsegnungsbräuche´, bei denen die junge Frau
beweisen muß, daß sie es den alten im Trinken und Tanzen gleich zu tun imstande
ist. Die sonst so schamhafte Setukesenfrau wird keck, und im Tanze hebt sich der
Rock höher als gewöhnlich“. Oder: „Auch diejenigen Weiber, die das erste Mal mit
den Weibern Schnaps trinken, d. h. die Jungvermählten, welche erst in diesem
Jahr in die Dorfgemeinde aufgenommen worden sind, bringen allein ein Liter
Schnaps, den ´Jungvermähltenschnaps´“. „Die Jungvermählten sind scheu, sie sind
zum ersten Mal auf dem Fest. Im zweiten Jahr haben sie schon größere Rechte, und
sie werden nicht mehr als Jungvermählte betrachtet, und dann haben sie auch das
Recht, alles zu tun“. Von anderen Dörfern heißt es: „Eine Jungvermählte wird
geehrt, mit einem Schemel unter Hurrarufen emporgehoben und sofort zur
Gesellschaft gezählt.“. „Welche erstmalig zum Weiberfest kamen (die
Jungvermählten), wurden unter Hurra hochgehoben, sie aber stellen dafür einen
Liter Schnaps“. In einem Dorf muß die Jungvermählte „der Bierverteilerin einen
Gürtel geben, einen Gürtel an den Schemel und einen Gürtel auf den Tisch, oder
da stellen die Jungvermählten der reicheren Gehöfte Handschuhe“.
Die einzelnen weiteren Begebenheiten des
Weiberfestes sind Essen, Trinken, Tanzen, Singen und Possentreiben. Zunächst das
Essen: Alles, was von den Dorfgenossen eingesammelt oder was die einzelnen
Frauen mitgebracht haben, wird durch die Ordnerin, die Wirtin, unter die
Teilnehmerinnen verteilt, so daß niemand zu kurz kommt. Quas und Piroggen
(Fleischpasteten) sind Hauptgerichte. Schon vor dem Essen wird getrunken Bier
und Schnaps (Aetherschnaps), „damit das Essen besser gehe“. Bier haben die
Weiber gewöhnlich eigens zu Fest selbstgebraut. Kennzeichnend für das Fest ist
die Unmäßigkeit im Trunke. So heißt es: Bier wird gebraut etwa einen Eimer für
jedes Weib“. „Die Weiber nötigen einander um die Wette und da mußt du schon aus
Not trinken“. „Nach dem Fest sind die Weiber so krank, daß sie nicht mehr
aufzustehen vermögen“. Oder ein anderer Bericht: „Nun feiern sie freilich an
manchem Ort das Fest zwei oder gar drei Tage. Am ersten Tag trinken sie, am
zweiten gehen sie ´den Kopf heilen´ (= den Kater vertrinken). Da heilen sie nun
den Kopf so lange, bis sie wieder berauscht werden... Am dritten Tag gehen die
Haupttrinkerinnen für sich dorthin... Bei manchem Weibe brüllt das Vieh vor
Hunger, die Wirtin aber steht aufrecht auf einem Faß“.
Es dauert nicht allzulange Zeit, dann erfaßt die
Weiber im Rausch toller Taumel und beschwingt heben sie die Beine im Tanze, der
mehr einem Hüfen gleicht. Vielfach wird der kleinrussische Kasatschok getanzt.
Aber „von allen Tänzen und Hüpfen der beste ist ´Der Setukese´“. „Den ´Setukesen´
tanzen die Weiber etwa in dieser Weise: Sie gehen zu Vieren im Kreise und fangen
an; die Tanzschritte sind sehr kurz, eher könntest du sagen, halbe Hüpfer. Ist
ein halber Kreis um, dann dreht sich jede auf ihrer Stelle zweimal um, das eine
Mal nach der einen Seite, das andere Mal nach der anderen Seite, nur alle in
derselben Weise. Und dann geht wiederum das Hüpfen weiter, die Beine erheben
sich gleichzeitig eines hinter dem anderen. Aber die Schritte sind kurz und
niedrig, dem Geräusch nach geht der Tanz in dieser Weise: Züchka, züchka, züchka...
Dieser Tanz hier ist ein Frauentanz, die Mädchen tanzen den ´Setukesen´ wenig
oder gar nicht“. „Getanzt wird der ´Setukese´ einfach nach dem Munde“, d. h. man
singt dazu.
Man vollführt aber auch noch besondere
Scherztänze. Man tanzt das „Großmutter-Dirndl“, „wo alle gebückt im Kreise sind,
die Hände unterm Gesäß der vorderen und gesungen wird;´Hatzuch! Hatzuch!
Großmutter-Dirndl´“. „Auch tanzen die Weiber dort noch einen Tanz. Das ist so:
eine steckt ihren Kopf zwischen den Beinen der anderen hindurch und umfaßt mit
den Händen die Beine, diejenige aber, zwischen deren Beinen der Kopf
durchgesteckt worden ist, neigt sich über jene und umfaßt mit den Händen deren
Gesäß. Dann gehen sie durch das Zimmer: die eine hebt die andere an den Füßen
empor, die andere wiederum am Gesäß, dann ist es wie ein Hüpfen“.
In zwei Fischerdörfern am Peipussee begegnet man
dem Singspiel folgender Art: „Nach dem Schmaus bilden die Frauen einen
bootartigen Kreis, wobei ihre Anführerin quasi den Steuermann darstellt; dabei
singen sie Lieder und markieren durch ihre schunkelnden Bewegungen das Schaukel
des Bootes“. Oder: „dann fing das Fest an. Die Frauen setzten sich auf der
Straße eine der anderen gegenüber, als ob sie eine Boot bildeten und fingen an
zu singen“. Was es mit dem Elsterntanz auf sich hat, wird leider nicht
berichtet.
An Liedern, die beim Tanz, Spiel und den Gängen
durchs Dorf gesungen werden, sind die Weiberfeste nicht arm. Entsprechend dem
Grundcharakter der Feier strotzen die meisten Gesänge von Anspielungen oder
derbrohen Offenheiten, die sich aufs Geschlechtsleben beziehen. Das in einem
Dorf am häufigsten gesungene Lied mag hier folgen:
„Ich war zu einem Fest, zu einem Schwätzlein,
und ich habe dort nicht Honig getrunken und nicht Sirup.
Sondern jungen, süßen Schnaps hab ich getrunken,
süßen Schnaps, alles Kirschenschnaps.
Ich habe nicht aus dem Spitzglas getrunken, nicht aus dem Teeglas.
Ich Junge habe aus dem vollen Eimer getrunken,
aus dem vollen Eimer über dem Rand vom Boden.
Auf den Hof ging ich, habe nicht geschwankt,
ich habe mich an der Schnur der Tür festgehalten.
Du mein Schnürlein, halte du mich, mich arme Trinkerin.
Wenn mich nur das Schwiegerväterlein nicht bemerken
und das Schwiegermütterlein nicht sehen würde.“
Im Rauschtaumel werden auf den Weiberfesten
mancherlei Possen getrieben. Man vermummt und verkleidet sich. „Wenn man sich
berauscht hat, dann macht man sich zur Königsfrau, zur Komödiantin, man zieht
sich Burschenkleider an und tut, was jemand eben noch verstehen mag“. Das
ausgelassene Treiben der Frauen richtet sich vornehmlich gegen den Mann, der
ihnen begegnet. „Wenn ein Mann mit den Weibern zusammentrifft, dann tun die
Weiber hundert Wunder mit dem Mann“. Ihm werden die Hosen heruntergerissen,
Schnee in die Hosen getan, das Gesäß mit „Pfeffer gesalbt“ und anderes mehr. Von
dem Weiberfest eines Dorfes heißt es: „Sind die Weiber bereits berauscht, dann
werden sie toll. Dann darf niemand durchs Dorf gehen. Wenn zufällig ein ´Wilder´
(= Mann aus dem Innern Estlands) oder ein Russe vorüber geht, dann ist die
Weiberschar ihm auf dem Buckel. Manche reißen die Männer nieder, manche klettert
auf und setzt sich aufs Pferd, und der Mann mag zusehen, wie er davonkommt. Wenn
aber irgend ein Heufuder durchzieht, dann wird es einfach umgestoßen. Die
Weiberschar zieht durchs Dorf, sie schlagen auf den Schneewehen Purzelbäume,
durchwaten alle vorhandenen Wasserlachen und machen dumme Streiche, wie es eben
jeder versteht“.
Auf dem Programm des Festes steht zuweilen auch
der „Spazierritt“, zu dem die Pferde des ganzen Dorfes hochgemacht werden. Man
klettert aufs Pferd, auch wenn es an den Wagen gespannt ist, und jagt davon.
Die Schranken- und Hemmungslosigkeit kennt in
einigen Dörfern keine Grenzen. So sagt ein Bericht: „Zur Festzeit kennen die
Weiber keine Scham (der Alte verbot, das aufzuschreiben, das sei häßlich, den
großen Herren lohne es sich nicht, solch einen Scherz aufzuschreiben“. Oder
ebenda: „Manchmal gehen auch etliche Männer hin und geben von sich aus Geld für
Getränke, aber das geschieht selten. Jener muß dann den Weibern zu Gefallen
sein“.
In verschiedenen Berichten über das russische und
estnische Weiberfest ist die Rede von Verkleidungen in Männertracht. Solche
kommen innerhalb der eigenen dörflichen Weibergemeinschaft vor. Einen höchst
bemerkenswerten Zug hinsichtlich der Burschenverkleidung enthält folgender
Bericht: „Ist man schon eine Zeitlang im fremden Dorf gewesen und hat gesungen,
dann macht man sich auf den Rückweg. Dann kleiden sich die geleitenden Weiber in
Burschenkleider und ziehen sich Pelze mit nach außen gekehrter Fellseite an, der
Mund wird mit Ruß verschmiert –wie alte Teufel sehen sie aus- und so wird man
unter Singen und Jauchzen abgeschickt“.
Andere Bräuche an solchen Weiberfesten beziehen
sich auf Hochzeit und Geburt. So wird „Hochzeit gespielt“, wie ein Bericht
aussagt: „Am zweiten Tag verkleiden wir uns, ´feiern Hochzeit´. Wir nehmen eine
Droschke (die Frauen spannen sich selbst als Pferde davor), setzen den Bräutigam
mit der Braut, Freunde und Freundinnen hinein, und die anderen Frauen gehen
hinterher und singen Hochzeitslieder“. Nachgeahmt wird auch das Schwangersein
dadurch, daß sich manche als „dickbäuchige Frau“ verkleidet. Andere Gebräuche
bewegen sich auf derselben Linie. „Wenn ein Weib keine Kinder hat, fangen die
Weiber zu hexen an: Sie bringen jenes Weib ins Schweinelager, und größtenteils
ist es auch richtig gegangen: das Weib bekommt ein Kind. Oder manche hat
wiederum viele Töchter und will, es solle etwa ein Sohn werden, tun die Weiber
dasselbe“. Oder: „Auf einem Weiberfest hat sich die Aufmerksamkeit der
betrunkenen Weiber auf eine unfruchtbare Frau konzentriert, die viele Jahre
vergeblich auf ein Kind gewartet hatte. Die Hausfrau, als Leiterin des
Weiberfestes, hatte zum besten dieser Frau ein langes Beschwörungslied
improvisiert, das von der ganzen Gesellschaft im Chor versweise wiederholt und
in welchem die Jungfrau Maria angefleht worden war, „die Läden der Frau
loszulassen und die Löcher der Frau zu öffnen“. Trunkenen Mutes hatten sie die
Frau ganz entkleidet und versucht, ihr Gebrechen zu ´heilen´ ... Und das größte
Wunder, daß das einfache Weib bis ins Innerste seiner Seele rührte, war gewesen,
daß die Frau im darauffolgenden Jahr schwanger geworden und einem Sohn das Leben
geschenkt hatte“. Auch auf folgende Weiseversuchten die Weiber Kindersegen
herbei zu locken: „Welch ein Weibe kinderarm ist oder überhaupt keine Kinder
hat, so wird diese mitten im Zimmer aufrecht auf einen Schemel gestellt, und die
anderen Weiber knien sich alle auf dem Boden nieder und beten zu Gott. Es wird
in dieser Weise gesungen, wenn sie auf den Knien sind:
´Gott, gib vier Beine zu Füßen
zwei Köpfe zu Häupten
Ofen hilf! Oberofen, lindere die Not!´
(Fußnote: In der Lagerstätte auf dem Ofen bringen
die Frauen alle Kinder zur Welt)
Haben sie ausgebetet, dann wird das Weib mit dem
Schemel dreimal emporgehoben... Meistens zieht das Weib natürlich ihre Kleider
aus, bevor sie auf den Schemel steigt. So erbittet man unfruchtbaren Weibern
Kinder“.
Der Förderung weiblicher Fruchtbarkeit mittels
sympathetischer Bräuche dienen auch folgende Sitten: „So sah ich, wie ein Weib
den ersten Becher Bier leer trank und den Rest, der im Glase verblieb, auf ihrem
Kopf ausklopfte... Ein anderes Weib goß sich vor dem Biertrinken ein wenig auf
den Schoß und trank erst dann ihr Glas leer“. Oder: „Manche ziehen sich weiße
Kleider an, verkleiden sich als Doktor oder Hebamme und gehen um, vielleicht hat
jemand Bauchweh“.
Noch von anderen, oft derben „Scherzen“, die auf
den Weiberfesten getrieben werden, erzählen die Berichte, so von der
„Hundehochzeit“, oder dem Brauch: „die Sau zum Eber führen“.
Nachdem die einzelnen Begebenheiten des
Weiberfestes durchmustert sind, wie sie laut Berichten sich hier und dort noch
heute im Baltikum abspielen, kann ein genauer Vergleich mit dem sudauischen
Fest- und Tanzspiel angestellt werden. Zunächst darf als gleichlautend mit den
baltischen Gepflogenheiten hervorgehoben werden, daß die sudauische Vorführung
eine ausschließliche Angelegenheit von verheirateten Frauen war. Die Erwähnung
der Männer, die von ferne dem Schauspiel beiwohnten, beweist diese Tatsache zur
Genüge. Aber auch „die Entblößung ihrer Haare, die gleich den Ohren
abgeschnitten“, zeugt hierfür. Denn nur verheiratete Frauen trugen bei den
Sudauern die Haare im Kurzschnitt. Am abend des Hochzeitstages wurde nämlich der
Braut nach alter Sitte diese Veränderung vorgenommen: „Wenn die Braut soll zu
Bett gehen, im Tantz kommt ihrer Freund einer und schneidet ihr das Haar ab.“
Einen „Bubikopf mit Pagenschnitt“ tragen nach Hussels Angabe in seinen Topogr.
Nachrichten II auch alle verheirateten Frauen am Peipussee, vornehmlich im
Koddaferschen. Dort wird dem jungen Weibe am Morgen nach der Hochzeitsnacht das
Haar abgeschnitten und ihr ein besonderes Band vor die Stirn gebunden. Die
Änderung der Haartracht der jungen Frau war, wie die Vergleichung lehrt, eine
altindogermanische, ebenso auch wie eine finno-ugrische Sitte, wenn auch nicht
immer mit einem Haarschnitt verbunden. Das Mädchen ließ das Haar frei fliegen,
in Locken, Zöpfen und dgl. m., der jungen Frau wurde es schlicht gescheitelt und
unter ein Tuch, Band, Netz einen Schleier oder eine Haube getan. Auch nach
altgermanischer Sitte durfte die verheiratete Frau das Haar nicht lose tragen,
sondern mußte die Frauenbinde, „daz gebende“, anlegen. Sie tat es gewöhnlich am
Morgen nach der Brautnacht selbst, oder es geschah auch durch die Mutter. Von
der Zeremonie der Handlung rührt heute noch die Bezeichnung „unter die Haube
kommen“ her. Diese Kopftücher bzw. Hauben hatten sich offensichtlich die
sudauischen Weiber abgerissen und dadurch ihre Haare entblößt. Diese teilweise
Entblößung scheint unter den baltischen Völkern gerade bei den Gelagen eine
Gepflogenheit gewesen zu sein. Das Nationalepos der Esten, Kalewipoeg,
überliefert bei der Schilderung der Schmauserei mit dem finnischen Schmied:
„Weiber warfen ihre Hauben
Jungfrauen ihre furcht beiseite“
und weiter
„Weiber ohne Hauben schrieen,
Männer ohne Mützen brüllten“
Auch in den Berichten über das baltische
Weiberfest ist mitunter von Entblößung die Rede. So heißt es von den Letten:
„Bei diesem Fest habe man manchmal sogar die Kleider abgeworfen“; und von den
estnischen Sekutesen: „Die Freiheit in Wort und Tat nimmt im Laufe des Essens
und Trinkens immer größere Ausmaße an und schließlich im teilweisen Abwerfen der
Kleider ihren Höhepunkt erreicht“.
Ein weiterer Vergleichspunkt: Die zehn
sudauischen Frauen trinken, bevor sie Tanz und Possenspiel beginnen, eine Tonne
Bier aus, gewiß ein Maß, das hinreichte, um sie in beschwingten Taumel zu
versetzen. Bei den Baltischen Weiberfesten liegt dasselbe Verhältnis vor: Mit
Tanzen, Singen und Possentreiben beginnt man erst, wenn man Alkohol in
reichlichen Mengen genossen und sich so aller Hemmungsgefühle entledigt hat. Daß
die altpreußische Frau an Trunkfestigkeit dem Mann nicht nachstand, ja ihn sogar
übertraf, dafür liegen Zeugnisse vor. Prätorius sagt in „Preußische Schaubühne“
über die Nadrauer, welche den Sudauern benachbart waren,: „Bei Gelagen können
die Weiber insgemein den Trunk mehr vertragen als die Männer“. Oder wenn es von
den Gepflogenheiten bei der sudauischen jährlichen Totenfeier heißt: Die Frauen
kommen den Männern vor, diese wechseln dann mit jenen ab, „bis sie nicht mehr
auf den Füßen stehen können“.
Der Vergleiche mit den baltische Weiberfesten
gibt es noch weitere. Wie dort hub unter den sudauischen Weibern im Rauschtaumel
des Alkohols ein Singen und Tanzen an und zwar ein „seltsames“. Die Tanzfiguren
müssen also von deutschgewohnten abgewichen sein; was liegt näher, als ihnen
ähnliche oder gar gleiche zu vermuten, wie sie in den baltischen Frauenfeiern
üblich sind.
Gerne hätte man über die „allerlei wunderlichen
Possen“, welche die sudauischen Frauen außerdem trieben, etwas Näheres erfahren.
Möglicherweise waren sie dem deutschen Augenzeugen unverständlich, da sie als
„wunderlich“ bezeichnet werden. Die Mitteilung, daß Possenscherze ein
Bestandteil der Vorführung waren, erlaubt es schon, auch hierin ein Ereignis zu
sehen, das sich mit gleichen Gepflogenheiten der weiberfeste deckt. Seltsam
mögen sie immerhin gewesen sein, zumal für einen nicht eingeweihten Deutschen,
der den aus Frauenstimmung erwachsenen und ausschließlich zu Frauengefühlen
sprechenden Handlungen fremd gegenüber stehen mußte.
Von weniger Belang ist die Mitteilung, daß die
Sudauerinnen geschmückt, also in Festtracht, das Tanzspiel ausführten. Jedoch
fügt auch dieser Umstand sich passend in das Gesamtbild ein und vervollständigt
die Vergleichspunkte, welche die sudauische Vorführung mit den baltischen
Weiberfeiern aufzuweisen hat. Alle Motive bewegen sich damit hier wie dort auf
gleichlaufender Linie, soweit der Chronist uns darüber Kenntnis gibt. Es dürfte
deshalb kaum ein Zweifel darüber bestehen, daß das sudauische Tanzspiel,
obgleich es auf den ersten Blick als vereinzeltes Tanzereignis erscheinen
könnte, trotzdem vom Standpunkt völkerkundlicher Betrachtung aus der
Vereinzelung herausgehoben und als ein Geschehnis volkseigenen Charakters
gedeutet werden muß, das in Sitte und Brauch begründet einer tieferen Sinngebung
zugänglich sein dürfte.
Daß den nordbaltischen Weiberfesten dem Ursprung
nach nicht die Bedeutung einer bloßen Orgie zukommt, dürfte nach allem, was wir
über Volksbräuche wissen, auf der Hand liegen. Man darf mit Sicherheit annehmen,
daß ihnen eine sakrale Handlung zugrunde liegt. In einem bestimmten
Motivenkomplex kommt zunächst der geheimbündische Charakter des Festes klar zum
Ausdruck. Dieser spiegelt sich wider in der Verschwiegenheit über die
Festvorgänge, im Fernsein der Männer und dem Verhalten ihnen gegenüber. In
überschäumender Lebenskraft lassen die Frauen ihren Übermut an ihnen in
mannigfacher Weise aus, wie es bei Naturvölkern unter gleichen Umständen zu
geschehen pflegt. Dort mißhandeln die Mitglieder von Geheimbünden bei ihren
Umzügen die Nichteingeweihten. Die Frauen fühlen sich als verschworene
Mitglieder einer Kultgemeinde, was eine Entsprechung findet in dem
Peko-Geheimkult der estnischen Männer. Auch die Einweihung der Jungvermählten in
die Weibergemeinschaft und zwar die Zwangsmäßigkeit dieser Zeremonie zeugt für
die geheimbündische Art des Weiberfestes. Das Auftreten der Frauen in
Verkleidung darf ebenfalls als ein hierfür kennzeichnendes Motiv gewertet
werden.
Der ursprüngliche eigentliche Sinn und Zweck des
Weiberfestes lag in der Erlangung der Fruchtbarkeit und somit in der Erfüllung
des Lebenszweckes der Frau, der Erhaltung der Familie und Sippe. Ein
umfangreicher Motivenbereich zeugt für diese ursprüngliche Bedeutung des Festes.
Ausgeschlossen von der Feier sind nämlich die
unverheirateten Mädchen und die alten Jungfern, also weibliche Mitglieder der
Dorfgemeinschaft, die für die Familienfortpflanzung unmittelbar nicht in Frage
kommen. Beachtung verdient ferner, daß in der Ausgestaltung des Festes
Verrichtungen vorliegen, die auf Hochzeit und Geburt Bezug haben; es wird
„Hochzeit“ gespielt und "Arzt“ und „Hebamme“ treten auf. Tänze werden dabei
unter Absingen pikanter Lieder aufgeführt, die keinen Zweifel darüber lassen,
daß es sich bei der Feier des Weiberfestes ursprünglich um Erstrebung der
Fruchtbarkeit gehandelt hat. Auch die pikante Behandlung der Männer spricht
hierfür, die, wenn sie den Weibern in die Hände fallen, sich völlig ihren Launen
unterwerfen müssen und sich nur durch Befriedigung der weiblichen Lüste
loskaufen können, was in neuerer Zeit durch einen Geldtribut zum Ankauf von
Schnaps abgelöst worden ist. Das sogenannte „Thomasfangen“ bei dem Weiberfest
der Kleinrussen in der Nähe von Saratow, das ursprünglich auf einen „Männerfang“
zum Zwecke der Fortpflanzung hinauslief, läßt über den primären Charakter
ebenfalls keinen Zweifel.
Im allgemeinen umfaßt der im Unterbewußtsein
brodelnde Geschlechtstrieb, wie er sich bei den Frauenfesten äußert,
Verrichtungen symbolischer Art, wozu das schon erwähnte Hochzeits- und
Geburtszeremoniell gehört. Auch gewisse Bemühungen, um Fruchtbarkeit für sterile
Frauen zu erzielen, sind als symbolische Akte, ja als Imitationszauber zu
deuten. Wenn sich ferner Frauen als Männer verkleiden und als Repräsentanten der
Männerwelt aufzutreten pflegen, dann beruht dieser Brauch wohl auf derselben
Vorstellung, wonach man magische Berührung mit dem anderen Geschlecht anstrebte.
Auf Grund der vorher dargelegten Vergleichspunkte
darf man auch dem vermuteten sudauischen Fest einen ursprüngliche
geheimbündischen Charakter und denselben Sinn und Zweck unterstellen, wie er den
nordbaltischen Frauenfeiern innewohnt.
Nunmehr noch ein Wort über den Alkohol. Ihm kam
und kommt bei den Weiberfesten eine grundlegende Funktion zu: „im Rausch sah man
eine übernatürliche Macht, die durch das gärende Bier oder eine andere
Flüssigkeit dämonisch in den menschlichen Körper eindringt und ihn quasi in
Besitz nimmt, so daß der Mensch einen ganz neuen Mut und eine ganz neue Kraft in
sich fühlt, sich in Worten und Taten spontan ausdrückt und in eine Art von
Ekstase gerät. eines solchen von außen kommenden Kraftzuschusses bedurfte es
besonders im Winter, wenn zum Frühling die Speisevorräte knapp wurden und eine
Zeit des Hungerns (im christlichen Milieu Fasten) begann. Diese Krafterneuerung
ging gemeinsam vor sich, um die Potenz der ganzen Dorfgemeinschaft zu heben. So
eignete sich der Alkohol als Kraftquelle für das Fruchtbarkeitsfest der Weiber“.
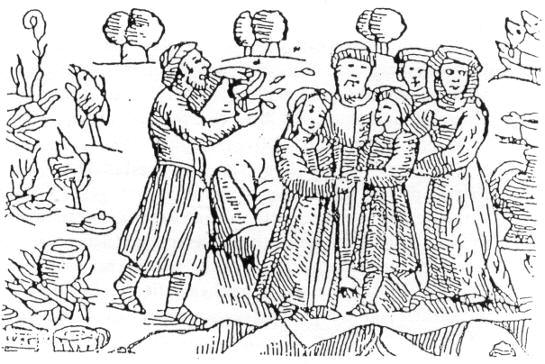 |
|
Hochzeitszeremonie der Prußen. (Olaus Magnus Venedig 1565) |
| |
|
 |
Quellen:
Tolkemita-Hefte - unter Verwendung folgender Literatur:
.Loorits, Oskar, Das sogenannte Weiberfest bei den Russen und Setukesen in
Estland, Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 1939;
.Schröder, Die Hochzeitsbräuche der Esten, 1888;
.Hussel, Topographische Nachrichten;
.Prätorius, Preußische Schaubühne, um 1700;
.Schurtz, Altersklassen und Männerbünde;
.M.J. Eisen, Estnische Mythologie – übersetzt von Ed. Erkes, 1925; |
|