|
| |
Der Landkreis Samland
entstand 1938 aus den Landkreisen Fischhausen und Königberg
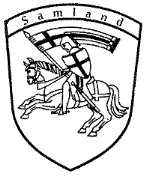 Der Landkreis Samland ist erst am 1. April 1939
aus den Landkreisen Fischhausen
und Königsberg gebildet worden;
er umfaßt eine Fläche von 1.923 qkm und hat 120.246 Einwohner, das sind 62,5 Einwohner
auf einem qkm. Er war der Fläche nach der größte Landkreis Ostpreußens, auch hatte
er die höchste Einwohnerzahl eines Landkreises. Das Kreisgebiet Samland erstreckt
sich fast über die ganze Halbinsel Samland. Possindern und Groß-Lindenau sind die
östlichsten Orte, im Süden reicht er über den Pregel hinaus bis ins Frischingtal,
wo Kobbelbude und Dopsattel die südlichsten Ortschaften sind. Auch Teile der Frischen
und der Kurischen Nehrung gehören zu ihm. Von der Natur ist er überaus reich ausgestattet.
Seiner Kliff- und Flachküste ist ein genügend breiter Strand mit feinem Seesand
vorgelagert. Deshalb haben sich besonders an der nördlichen Küste Ostseebäder und
ideale Fremdenverkehrsorte (Cranz, Rauschen, Georgenswalde, Groß-
und Klein-Kuhren, Neukuhren) entwickelt, die wie die beiden Nehrungen mit ihren
Sandwüsten, Wäldern und altertümlichen Fischerhäusern in jedem Jahr Tausende von
Besuchern anzogen. Reizvoll ist auch das Landesinnere mit seinen anmutigen Landschaftsformen
und uralten Dörfern. Das Alkgebirge mit seinen waldbestandenen Höhen und Kuppen,
Schluchten und Tälern, sehenswerte Kirchen und Burgruinen waren beliebte Ausflugsziele
der Königsberger, aber auch von Bewohnern der Provinz und Fremden. Der 110 m hohe
Galtgarben, der 89 m hohe Große Hausen nördlich Germau und andere Erhebungen sind
geschichts- und sagenreich. Eine Fülle von urgeschichtlichen Funden beweist, daß das Samland uraltes Kulturland
ist. In der Bronzezeit bestanden zwischen den samländischen Bewohnern und denen
des Weichselmündungsgebiets enge Beziehungen, in der nachchristlichen Zeit zwischen
den Prußen und den nordischen Ländern, besonders mit den Dänen und Wikingern. Eine
Menge prußischer Orts- und Flurnamen wie ur- und frühgeschichtliche Gräberfelder
lassen auf eine dichte Besiedlung des Samlands schließen. Der große Wikingerfriedhof
in Wiskiauten bei Cranz beweist, daß die Wikinger im 9. und 10. Jahrhundert am später
versandeten Seetief bei Cranz ansässig gewesen sind. Der Deutsche
Orden, der in der Mitte des 13. Jahrhunderts im Samland Fuß faßte, knüpfte an
die geschichtsreiche Vergangenheit an, beließ den Prußen ihre Felder, erbaute Burgen
und Städte, belehnte Prußen sowie Deutsche und schuf wenige deutsche Bauerndörfer.
Seit Jahrtausenden ist das Samland
das Bernsteinland. Bereits in der Steinzeit wurde der Bernstein von den Ureinwohnern
geschätzt, und in den folgenden Zeiten wurde das samländische Gold eine wichtige
Handelsware. Die eingeborenen Prußen liebten und verwendeten den Bernstein und tauschten
und handelten ihn ein gegen Waffen, Schmuck, Münzen u. a. Phönizier, Agypter, Griechen
und Römer begehrten das samländische Gold und sandten ihre Händler ins Samland. Am Ostufer des Frischen
Haffs lief die Bernsteinstraße entlang über Truso (Elbing) nach der Weichsel, der
Oder, durch die Mährische Pforte über den Semmering bis Rom und nach anderen Orten.
Hatte man den Bernstein in alter Zeit am Strande aufgelesen, mit Keschern „geschöpft",
mit Stangen gestochen oder durch Taucher oder Bagger gewonnen, so wurde er seit
1872 an der Westküste bei Palmnicken und Kraxtepellen auch bergmännisch aus
der Blauen Erde gewonnen, geschlämmt, sortiert und in Königsberg und Danzig verarbeitet; der Tagebau
wurde 1913 östlich Kraxtepellen aufgenommen; im Jahre 1934 wurden 600 Tonnen Rohbernstein
gefördert. Der Landkreis Samland ist erst am 1. April 1939
aus den Landkreisen Fischhausen
und Königsberg gebildet worden;
er umfaßt eine Fläche von 1.923 qkm und hat 120.246 Einwohner, das sind 62,5 Einwohner
auf einem qkm. Er war der Fläche nach der größte Landkreis Ostpreußens, auch hatte
er die höchste Einwohnerzahl eines Landkreises. Das Kreisgebiet Samland erstreckt
sich fast über die ganze Halbinsel Samland. Possindern und Groß-Lindenau sind die
östlichsten Orte, im Süden reicht er über den Pregel hinaus bis ins Frischingtal,
wo Kobbelbude und Dopsattel die südlichsten Ortschaften sind. Auch Teile der Frischen
und der Kurischen Nehrung gehören zu ihm. Von der Natur ist er überaus reich ausgestattet.
Seiner Kliff- und Flachküste ist ein genügend breiter Strand mit feinem Seesand
vorgelagert. Deshalb haben sich besonders an der nördlichen Küste Ostseebäder und
ideale Fremdenverkehrsorte (Cranz, Rauschen, Georgenswalde, Groß-
und Klein-Kuhren, Neukuhren) entwickelt, die wie die beiden Nehrungen mit ihren
Sandwüsten, Wäldern und altertümlichen Fischerhäusern in jedem Jahr Tausende von
Besuchern anzogen. Reizvoll ist auch das Landesinnere mit seinen anmutigen Landschaftsformen
und uralten Dörfern. Das Alkgebirge mit seinen waldbestandenen Höhen und Kuppen,
Schluchten und Tälern, sehenswerte Kirchen und Burgruinen waren beliebte Ausflugsziele
der Königsberger, aber auch von Bewohnern der Provinz und Fremden. Der 110 m hohe
Galtgarben, der 89 m hohe Große Hausen nördlich Germau und andere Erhebungen sind
geschichts- und sagenreich. Eine Fülle von urgeschichtlichen Funden beweist, daß das Samland uraltes Kulturland
ist. In der Bronzezeit bestanden zwischen den samländischen Bewohnern und denen
des Weichselmündungsgebiets enge Beziehungen, in der nachchristlichen Zeit zwischen
den Prußen und den nordischen Ländern, besonders mit den Dänen und Wikingern. Eine
Menge prußischer Orts- und Flurnamen wie ur- und frühgeschichtliche Gräberfelder
lassen auf eine dichte Besiedlung des Samlands schließen. Der große Wikingerfriedhof
in Wiskiauten bei Cranz beweist, daß die Wikinger im 9. und 10. Jahrhundert am später
versandeten Seetief bei Cranz ansässig gewesen sind. Der Deutsche
Orden, der in der Mitte des 13. Jahrhunderts im Samland Fuß faßte, knüpfte an
die geschichtsreiche Vergangenheit an, beließ den Prußen ihre Felder, erbaute Burgen
und Städte, belehnte Prußen sowie Deutsche und schuf wenige deutsche Bauerndörfer.
Seit Jahrtausenden ist das Samland
das Bernsteinland. Bereits in der Steinzeit wurde der Bernstein von den Ureinwohnern
geschätzt, und in den folgenden Zeiten wurde das samländische Gold eine wichtige
Handelsware. Die eingeborenen Prußen liebten und verwendeten den Bernstein und tauschten
und handelten ihn ein gegen Waffen, Schmuck, Münzen u. a. Phönizier, Agypter, Griechen
und Römer begehrten das samländische Gold und sandten ihre Händler ins Samland. Am Ostufer des Frischen
Haffs lief die Bernsteinstraße entlang über Truso (Elbing) nach der Weichsel, der
Oder, durch die Mährische Pforte über den Semmering bis Rom und nach anderen Orten.
Hatte man den Bernstein in alter Zeit am Strande aufgelesen, mit Keschern „geschöpft",
mit Stangen gestochen oder durch Taucher oder Bagger gewonnen, so wurde er seit
1872 an der Westküste bei Palmnicken und Kraxtepellen auch bergmännisch aus
der Blauen Erde gewonnen, geschlämmt, sortiert und in Königsberg und Danzig verarbeitet; der Tagebau
wurde 1913 östlich Kraxtepellen aufgenommen; im Jahre 1934 wurden 600 Tonnen Rohbernstein
gefördert.
Die Patenschaft über den Landkreis Königsberg
hat der Kreis
Minden übernommen, die für den Landkreis Fischhausen der Kreis Pinneberg
(Holstein).
 |
Quellen:
Wappen: Samländischer Heimatbrief "Unser schönes Samland",
Kreisgemeinschaft Fischhausen (www.kreis-fischhausen.de/),
2002;
Text: Guttzeit: Ostpreußen in 1440
Bildern, Verlag Rautenberg, 1972-1996, Seite 32-35
|
|