|
| |
Der Landkreis Lyck /
Ostpreußen
 Der
Landkreis Lyck ist 1.115,06 qkm groß und hat 56.417 Einwohner, das sind 50,6 auf
1 qkm. Er ist ein Grenzkreis, liegt an der Landesgrenze mit Polen und gehört zur
Masurischen Seenplatte. Der größte See ist der Große Selmentsee, dem aus dem
Kreis Treuburg der Legafluß zufließt; dieser verläßt ihn als Malkiehn und mündet
in den reich gegliederten Statzer See; nur dessen nördliche Teile gehören zum
Kreise Lyck. Der Laschmiedensee empfängt von Norden den Lyckfluß, er verläßt den
See bei Stradaunen, durchfließt den Halecksee und bildet bei der Kreisstadt Lyck
den Lycker See. Von der Gesamtfläche des Kreises werden 730,21 qkm
landwirtschaftlich genutzt, und zwar überwiegend von mittleren Bauernbetrieben.
Viele von ihnen betrieben anerkannte Viehzucht und belieferten die zahlreichen
Molkereien. Die Wälder bedecken eine Fläche von 140,70 qkm. Das Holz wurde in
den heimischen Sägewerken bearbeitet und fand Absatz bei den Sperrholz-, Möbel-
und Kistenfabriken. Die Kreisstadt Lyck liegt fast in der Mitte des Kreisgebiets
und erstreckt sich am östlichen Steilufer des Lycker Sees und an der Mündung des
Lyckflusses. Der Komtur zu Balga, Ulrich von Jungingen, errichtete auf einer
Insel des Sees ein Ordenshaus, das 1398 vorhanden war und um 1400 seine
endgültige Gestalt erhielt. 1454 wurde es von den Polen durch Brand zerstört, so
daß nur noch „Reste des Haupthauses in den starken unteren Mauern" des seit 1879
bestehenden Gefängnisses erhalten sind. An dem gegenüberliegenden Ufer ließen
sich Ansiedler nieder, denen der Hochmeister Paul von Rusdorf 1425 eine
Handfeste verlieh. Das Dorf erhielt den Namen Zur Likke. In den unruhigen Zeiten
des 15. Jahrhunderts konnte es sich nicht voll entwickeln. Es besaß aber schon
1472 eine Kirche auf der höchsten Erhebung; sie mußte im 16. und 19. Jahrhundert
neu erbaut werden. Das jetzige Gotteshaus entstand 1922/1925 im Anschluß an die
Reste der 1850 vollendeten und 1914 zerstörten Kirche. An ihr wirkten seit der
Reformation zwei, seit 1894 drei Geistliche. Bemerkenswert, ist die Berufung des
aus Neu-Sandez bei Krakau stammenden Druckers Johannes Maletius 1537 zum
Erzpriester durch Herzog Albrecht. Er und sein Sohn Hieronymus Maletius
richteten in Regelnitzen (Regelnhof) bei Lyck eine Druckerei ein, in der sie die
Bibel und zahlreiche evangelische Lehr- und Glaubensschriften in polnischer
Sprache druckten. Hierdurch wurde die evangelische Lehre in Masuren sehr
gefördert. Vater und Sohn Maletius sollen auch die Kirchschule neu begründet
haben; Markgraf Georg Friedrich er hob sie 1587 zur Provinzialschule, 1599 zur
Fürstenschule; aus ihr ist das Gymnasium hervorgegangen. Die Lycker Schule
bildete masurisch sprechende Knaben für das Studium an der Universität in
Königsberg vor, dadurch wurde sie zum geistigen Mittelpunkt des evangelischen
Masuren. 1560 hatte Herzog Albrecht dem Dorf Lyck das Marktrecht verliehen und
es damit auch zum wirtschaftlichen Hauptort des östlichen masurischen Raumes
gemacht. Hierbei wirkte sich die Grenznähe vorteilhaft aus, weil damals mit
Polen ein reger Tauschhandel bestand. Im 16. Jahrhundert verlor Lyck durch die
Pest mehrere hundert Bewohner, weit mehr beim Tatareneinfall 1656/1657. Das Dorf
ging in Flammen auf. Nach dem Wiederaufbau erhob der Große Kurfürst den Flecken
zur Stadt. In dieser Zeit erhielt Lyck das erste Rathaus; es brannte mehrmals
ab, das jetzige wurde 1925 vollendet. In den Jahren 1709/1710 starben von etwa
1.700 Einwohnern 1.100 an der Pest. Von diesen Schicksalsschlägen konnte sich
die Stadt im 18. Jahrhundert kaum erholen, weil auch der Marktverkehr nachließ.
Eine Förderung brachte die seit 1742 bestehende Garnison. Der General Freiherr
von Günther, 1788/1795 in Lyck, verteidigte mit seinen Bosniaken die gefährdeten
Grenzstädte gegen die aufständischen Polen. Er soll auch die Einrichtung des
Lehrerseminars Lyck angeregt haben (1800-1803 und 1902-1926). Die Stadt Lyck
errichtete dem General zu Ehren ein Denkmal. Während der Kriegsjahre 1806/1812
erlebte die Stadt drückende Truppendurchzüge und Einquartierungen. 1831, 1844,
1853 forderte die Cholera in der Stadt jedesmal mehrere hundert Menschenleben.
1853 wurde die katholische Kirche, 1859 die Synagoge erbaut. Eine lebhafte
Aufwärtsentwicklung setzte aber erst nach dem Anschluß an die Südbahn 1868, mit
Prostken 1870 ein. Die Einwohnerzahl stieg von 3.898 (1850) auf 13.428 (1910).
Handel und Wandel hatten sich stark vermehrt. Maschinenfabriken,
Holzschneidemühlen, Ziegeleien, Brauereien und andere industrielle Unternehmen
gewannen an Bedeutung. Da in Lyck auch mehrere Schulen aller Art, Behörden,
Banken, Zeitungen bestanden, wurde es wegen seiner wirtschaftlichen und
kulturellen Bedeutung als die „Hauptstadt Masurens" angesehen. Der Erste
Weltkrieg brachte erhebliche Rückschläge, 1914/1915 wurde die Stadt dreimal von
den Russen besetzt und zu 45 v. H. zerstört. Auch das Kreisgebiet erlitt viele
Verluste. Mehr als 100 Heldenfriedhöfe, es sei nur die Höhe Bunelka genannt,
zeugen von den schweren Kämpfen und Verlusten. Bei der Abstimmung am 11. Juli
1920 wurden 8.339 (im Kreise 36.534) deutsche Stimmen und sieben (im Kreise 44)
polnische Stimmen abgegeben. Nach dem Wiederaufbau der Stadt setzte eine
allmähliche Aufwärtsentwicklung ein. Der gewinnbringende Grenzverkehr fiel fort.
Es entwickelte sich ein beachtlicher Getreide-, Leder- und Viehhandel. Bedeutung
gewannen die Sägewerke und Möbelfabriken. In den dreißiger Jahren hatten die
Lycker Teppichknüpferei und die Kreisweberei einen guten Ruf. 1929 wurden
Stadtgebiet und Bewohnerzahl vergrößert, als die „Domäne", d. h. die Lyckinsel
mit dem Schloß, der Borrekwald und der Lycksee, eingemeindet wurden. 1939 hatte
Lyck 16.500 Einwohner. Im September 1939 war die Stadt ein großes
Durchgangslager. Als 1945 die Russen nördlich und südlich des Kreises die
deutsche Front durchbrachen und der Kreis Lyck dadurch abgeschnitten zu werden
drohte, mußte er am 21./23. Januar 1945 kampflos geräumt und dem Feind belassen
werden. Seit Mai 1945 gehört er zum polnisch besetzten Teil Ostpreußens. Der
Landkreis Lyck ist 1.115,06 qkm groß und hat 56.417 Einwohner, das sind 50,6 auf
1 qkm. Er ist ein Grenzkreis, liegt an der Landesgrenze mit Polen und gehört zur
Masurischen Seenplatte. Der größte See ist der Große Selmentsee, dem aus dem
Kreis Treuburg der Legafluß zufließt; dieser verläßt ihn als Malkiehn und mündet
in den reich gegliederten Statzer See; nur dessen nördliche Teile gehören zum
Kreise Lyck. Der Laschmiedensee empfängt von Norden den Lyckfluß, er verläßt den
See bei Stradaunen, durchfließt den Halecksee und bildet bei der Kreisstadt Lyck
den Lycker See. Von der Gesamtfläche des Kreises werden 730,21 qkm
landwirtschaftlich genutzt, und zwar überwiegend von mittleren Bauernbetrieben.
Viele von ihnen betrieben anerkannte Viehzucht und belieferten die zahlreichen
Molkereien. Die Wälder bedecken eine Fläche von 140,70 qkm. Das Holz wurde in
den heimischen Sägewerken bearbeitet und fand Absatz bei den Sperrholz-, Möbel-
und Kistenfabriken. Die Kreisstadt Lyck liegt fast in der Mitte des Kreisgebiets
und erstreckt sich am östlichen Steilufer des Lycker Sees und an der Mündung des
Lyckflusses. Der Komtur zu Balga, Ulrich von Jungingen, errichtete auf einer
Insel des Sees ein Ordenshaus, das 1398 vorhanden war und um 1400 seine
endgültige Gestalt erhielt. 1454 wurde es von den Polen durch Brand zerstört, so
daß nur noch „Reste des Haupthauses in den starken unteren Mauern" des seit 1879
bestehenden Gefängnisses erhalten sind. An dem gegenüberliegenden Ufer ließen
sich Ansiedler nieder, denen der Hochmeister Paul von Rusdorf 1425 eine
Handfeste verlieh. Das Dorf erhielt den Namen Zur Likke. In den unruhigen Zeiten
des 15. Jahrhunderts konnte es sich nicht voll entwickeln. Es besaß aber schon
1472 eine Kirche auf der höchsten Erhebung; sie mußte im 16. und 19. Jahrhundert
neu erbaut werden. Das jetzige Gotteshaus entstand 1922/1925 im Anschluß an die
Reste der 1850 vollendeten und 1914 zerstörten Kirche. An ihr wirkten seit der
Reformation zwei, seit 1894 drei Geistliche. Bemerkenswert, ist die Berufung des
aus Neu-Sandez bei Krakau stammenden Druckers Johannes Maletius 1537 zum
Erzpriester durch Herzog Albrecht. Er und sein Sohn Hieronymus Maletius
richteten in Regelnitzen (Regelnhof) bei Lyck eine Druckerei ein, in der sie die
Bibel und zahlreiche evangelische Lehr- und Glaubensschriften in polnischer
Sprache druckten. Hierdurch wurde die evangelische Lehre in Masuren sehr
gefördert. Vater und Sohn Maletius sollen auch die Kirchschule neu begründet
haben; Markgraf Georg Friedrich er hob sie 1587 zur Provinzialschule, 1599 zur
Fürstenschule; aus ihr ist das Gymnasium hervorgegangen. Die Lycker Schule
bildete masurisch sprechende Knaben für das Studium an der Universität in
Königsberg vor, dadurch wurde sie zum geistigen Mittelpunkt des evangelischen
Masuren. 1560 hatte Herzog Albrecht dem Dorf Lyck das Marktrecht verliehen und
es damit auch zum wirtschaftlichen Hauptort des östlichen masurischen Raumes
gemacht. Hierbei wirkte sich die Grenznähe vorteilhaft aus, weil damals mit
Polen ein reger Tauschhandel bestand. Im 16. Jahrhundert verlor Lyck durch die
Pest mehrere hundert Bewohner, weit mehr beim Tatareneinfall 1656/1657. Das Dorf
ging in Flammen auf. Nach dem Wiederaufbau erhob der Große Kurfürst den Flecken
zur Stadt. In dieser Zeit erhielt Lyck das erste Rathaus; es brannte mehrmals
ab, das jetzige wurde 1925 vollendet. In den Jahren 1709/1710 starben von etwa
1.700 Einwohnern 1.100 an der Pest. Von diesen Schicksalsschlägen konnte sich
die Stadt im 18. Jahrhundert kaum erholen, weil auch der Marktverkehr nachließ.
Eine Förderung brachte die seit 1742 bestehende Garnison. Der General Freiherr
von Günther, 1788/1795 in Lyck, verteidigte mit seinen Bosniaken die gefährdeten
Grenzstädte gegen die aufständischen Polen. Er soll auch die Einrichtung des
Lehrerseminars Lyck angeregt haben (1800-1803 und 1902-1926). Die Stadt Lyck
errichtete dem General zu Ehren ein Denkmal. Während der Kriegsjahre 1806/1812
erlebte die Stadt drückende Truppendurchzüge und Einquartierungen. 1831, 1844,
1853 forderte die Cholera in der Stadt jedesmal mehrere hundert Menschenleben.
1853 wurde die katholische Kirche, 1859 die Synagoge erbaut. Eine lebhafte
Aufwärtsentwicklung setzte aber erst nach dem Anschluß an die Südbahn 1868, mit
Prostken 1870 ein. Die Einwohnerzahl stieg von 3.898 (1850) auf 13.428 (1910).
Handel und Wandel hatten sich stark vermehrt. Maschinenfabriken,
Holzschneidemühlen, Ziegeleien, Brauereien und andere industrielle Unternehmen
gewannen an Bedeutung. Da in Lyck auch mehrere Schulen aller Art, Behörden,
Banken, Zeitungen bestanden, wurde es wegen seiner wirtschaftlichen und
kulturellen Bedeutung als die „Hauptstadt Masurens" angesehen. Der Erste
Weltkrieg brachte erhebliche Rückschläge, 1914/1915 wurde die Stadt dreimal von
den Russen besetzt und zu 45 v. H. zerstört. Auch das Kreisgebiet erlitt viele
Verluste. Mehr als 100 Heldenfriedhöfe, es sei nur die Höhe Bunelka genannt,
zeugen von den schweren Kämpfen und Verlusten. Bei der Abstimmung am 11. Juli
1920 wurden 8.339 (im Kreise 36.534) deutsche Stimmen und sieben (im Kreise 44)
polnische Stimmen abgegeben. Nach dem Wiederaufbau der Stadt setzte eine
allmähliche Aufwärtsentwicklung ein. Der gewinnbringende Grenzverkehr fiel fort.
Es entwickelte sich ein beachtlicher Getreide-, Leder- und Viehhandel. Bedeutung
gewannen die Sägewerke und Möbelfabriken. In den dreißiger Jahren hatten die
Lycker Teppichknüpferei und die Kreisweberei einen guten Ruf. 1929 wurden
Stadtgebiet und Bewohnerzahl vergrößert, als die „Domäne", d. h. die Lyckinsel
mit dem Schloß, der Borrekwald und der Lycksee, eingemeindet wurden. 1939 hatte
Lyck 16.500 Einwohner. Im September 1939 war die Stadt ein großes
Durchgangslager. Als 1945 die Russen nördlich und südlich des Kreises die
deutsche Front durchbrachen und der Kreis Lyck dadurch abgeschnitten zu werden
drohte, mußte er am 21./23. Januar 1945 kampflos geräumt und dem Feind belassen
werden. Seit Mai 1945 gehört er zum polnisch besetzten Teil Ostpreußens.
In Lyck wurden am 8.
Juni 1756 der gänzlich erblindete Historiker Ludwig v. Baczko (+ Königsberg
1823), am 17. März 1926 der Schriftsteller Siegfried Lenz geboren. In dem in der
Nähe der Stadt Lyck gelegenen Forsthaus Sybba
haben die beiden Erzähler Fritz und Richard Skowronnek ihre Kindheit verlebt.
Das Dorf ist ein beliebter Ausflugsort. Malleten (Malleczewen) ist der
Geburtsort des am 11. August 1884 geborenen Schriftstellers Fritz Reck (+ KZ
Dachau 1945). Das am Lyckfluß und unweit der polnischen Grenze gelegene Dorf
Prostken ist allgemein als Endstation der Südbahn bekannt. Der Ort erinnert auch
an ein geschichtliches Ereignis. Am 18. Oktober 1656 fand bei Prostken eine
Schlacht statt, in der die Polen und Tataren die preußischen und schwedischen
Truppen besiegten und danach das südliche und östliche Ostpreußen bis Ragnit
hinauf plündernd, brennend und mordend bis zum Frühjahr 1657 durchzogen. Dabei
kamen 23.000 Menschen um, und 34.000 wurden in die Gefangenschaft geschleppt.
Gleichfalls am Lyckfluß liegt das
Kirchdorf Scharfenrade (Ostrokollen) mit einer 1667 erbauten und 1933
restaurierten dreischiffigen Holzkirche in Bohlenwandbau auf Feldsteinsockel,
sie ist außen und innen mit Brettern verschalt und gehört zu den seltensten
Holzkirchen Ostpreußens.
In Dreimühlen (Kallinowen) wirkte 1780/1798 der
Pfarrer Michael Pogorzelski, den Krüppelvater Braun „ein urwüchsiges Original
Masurens" genannt hat, der tatsächlich ein geistig hochstehender Geistlicher
war. Sein Vorgänger Bernhard Rostock (1730/1759) ist der Dichter des in
Masuren beliebten geistlichen
Volksliedes: „Das Feld ist weiß, der Ähren Häupter neigen sich." Das Kirchdorf
Stradaunen am südlichsten Zipfel des Laschmiedensees hat eine 1736/1738 erbaute,
chorlose Feldsteinkirche. In herzoglicher Zeit stand hier ein „Schloß", der
Verwaltungssitz des Amtes Stradaunen.
Das landschaftlich reizvoll
gelegene Kirchdorf Fließdorf (Jucha) war durch seine jährlich abgehaltenen Vieh-
und Pferdemärkte bekannt. Die Kirche war jahrhundertelang ein vielbesuchter
Wallfahrtsort. Sie war um 1585 erbaut, die geschnitzte Kanzel von 1574, der
Altar „wie die meisten masurischen dieser Zeit noch in Schreinform" von 1591.
In dem zwischen drei Seen gelegenen Kirchdorf Klaussen
wurde 1851 eine meteorologische Wetterstation eingerichtet, die durch ihre
jahrelangen Beobachtungen der Wisssenchaft wertvolle Dienste geleistet hat.
Skomanten (Skomentnen), das an den Sudauerführer Skomand in der Landschaft
Grasima (östlich Lyck) erinnert, ist bekannt geworden durch den in einem Tongefäß gefundenen
Silberschatz (Halskette mit kreuzförmigen Anhängern, je zwei Hufeisenfibeln und
Armspiralen) des 12./13. Jahrhunderts
Patenschaftsträger für den Kreis Lyck
ist die Stadt Hagen (Westf).
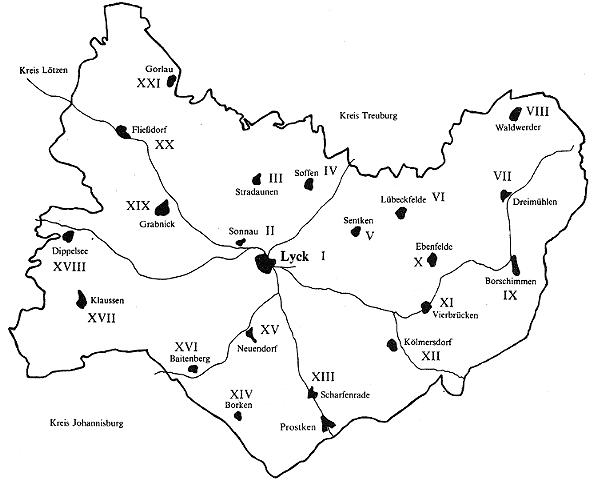
 |
Quellen:
Karte: Kreisgemeinschaft Lyck;
Bild und Wappen: Archivmaterial;
Text: Guttzeit: Ostpreußen in 1440 Bildern, Verlag Rautenberg, 1972-1996,
Seite 71 |
weitere Informationen:
Die Winterschlacht in Masuren 7. - 21. Februar 1915;
"Die Herkunft von Ortsnamen im Kreis Lyck" - Hagen-Lycker Brief 1998, Seite
119-123;
"500 Jahre Borschimmen" - - Hagen-Lycker Brief 2003, Seite 31-32 und 37-40;
"Die Apotheken im Kreise Lyck" - Hagen-Lycker Brief 2003, Seite 85-100;
"Else Erbe, Schriftstellerin aus Lyck" - Hagen-Lycker Brief 2003, Seite 101-108
|